Beradt, Martin,
Dr. jur.
geb. 26.08.1881 Magdeburg,
gest. 26.11.1949 New York (USA),
Rechtsanwalt, Schriftsteller.
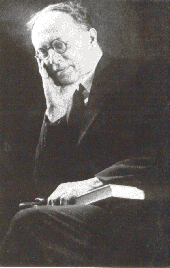
|
Beradt, Martin,
Dr. jur. |
|
B., Kind des jüdisch-orthodoxen Ehepaares Otto und Clara B., geb. Weyl, das einen bescheidenen Lederhandel in Magdeburg betrieb, lebte bis zum elften Lebensjahr im Elternhaus und besuchte 1888–92 das Magdeburger Domgymnasium. Danach verzog die Familie nach Berlin, wo B. Schüler des Gymnasiums zum Grauen Kloster wurde, das er 1899 mit dem Abitur verließ. Anschließend studierte er in Berlin, München und Heidelberg Jura, bestand Anfang 1901 sein Referendarexamen und wurde noch im selben Jahr in Freiburg/ Breisgau zum Dr. jur. promoviert. Nach seiner Referendarzeit in Bitterfeld und Berlin arbeitete B. ab 1909 als Assessor und Rechtsanwalt am Kammergericht in Berlin. In Charlottenburg eröffnete er eine Anwaltspraxis. Der überraschende Erfolg seines ersten Romans “Go” (1909) machte ihn zu einem Prominenten im kulturellen Leben der Reichshauptstadt. So gehörte er auch 1910 zu den Gründern eines literarischen Stammtischs (ab 1914 unter dem Namen Donnerstagsgesellschaft), dem bedeutende Künstler, Gelehrte und Politiker angehörten, u. a. Richard Dehmel, Moritz Heimann, Oskar Loerke, Martin Buber, Micha Josef Bin-Gorion, Emil Orlik, Eduard Stucken und Walter Rathenau. Eine besonders enge Freundschaft auf der Basis gleicher Anschauungen verband ihn mit dem Verleger Samuel Fischer. 1914 wurde B. als Pionier zum Kriegsdienst eingezogen. Nach dem Krieg widmete sich B. verstärkt seiner Anwaltspraxis. Seit Anfang der 1930er Jahre unternahm er Reisen nach Polen, um das Leben der Juden zu studieren. 1933 zwangen ihn die Nationalsozialisten zur Aufgabe seines Berufs, 1938 wurde ihm die Zulassung als Rechtsanwalt entzogen. In letzter Minute gelang ihm 1939 die Emigration – zunächst nach England, dann in die USA. Seine Hoffnung, dort ungehindert sein literarisches Schaffen fortsetzen zu können, erfüllte sich nicht. Der aus Deutschland als Manuskript gerettete Roman “Die Straße der kleinen Ewigkeit” fand keinen Verleger und wurde erst 1965 postum veröffentlicht. In ihm erzählt B. vom beengten Leben jüdischer Einwanderer aus Polen in der einzigen Berliner Judengasse, der Grenadierstraße, und setzt sich mit der Situation dieser Menschen im Deutschland der 1930er Jahre auseinander. Eine in New York geschriebene Sammlung. von Novellen mit dem Titel “The Sons of the House”, die alle das Exilthema behandeln, ist bislang nicht erschienen. B.s wichtigstes Werk ist der Roman “Erdarbeiter. Aufzeichnungen eines Schanzsoldaten”, eine realistische, simplizianisch gestaltete Auseinandersetzung mit dem Krieg. Ein Vorabdruck des bereits 1916 verfaßten Romans in einer großen Zeitung wurde verboten. “Erdarbeiter” ist einer der ersten deutschen Antikriegsromane nach dem I. Weltkrieg. Der kleinen Auflage von 1919 im S. Fischer Verlag folgte 1929 eine größere unter dem Titel “Schipper an der Front”. Das Buch, dessen Protagonist ein Anti-Held ist, wurde 1935 von den Nationalsozialisten erneut auf den Index verbotener Schriften gesetzt.
Werke: s. o.; Der (deutsche) Richter, 1909, 21930 (Repr. 1979); Eheleute, 1910, 51911; Das Kind, 1910; Die Verfolgten. Novellen, 1919; Leidenschaft und List, 1928.
Nachlaß: DLA Marbach.
Literatur: Killy 1, 431f.; Charlotte B., M. B. – sein Kreis und sein Werk, in: Bulletin der Leo Baeck Institute 8, Nr. 29–32, 1965;Klaus Washausen, Ein Vergessener. Zur Erinnerung an den Schriftsteller M. B., in: Magdeburger Bll. 1985, 55–61; Kirsten Steffen (Hg.), “Haben sie mich gehaßt?” Antworten für M. B. (1881–1949). Schriftsteller, Rechtsanwalt, Berliner jüdischen Glaubens. Mit Abdruck einer unveröffentlichten Erzählung des Autors sowie einer umfassenden Bibliographie, 1999 (W); Lovis Maxim Wambach, Grenzgänger zwischen Jurisprudenz und Literatur Werner Krauss, Kurt Tucholsky, Friedrich Georg Jünger und M. B., 2000.
Bildquelle: DLA Marbach; *Hanno Kühnert, Schallstadt-Mengen (privat).
Klaus Washausen